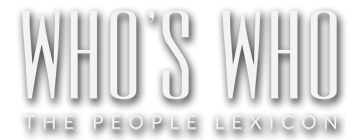Die Hexenverfolgung 1430 - 1782
Hexenverbrennung und Legitimation der Hexenverfolgung
Die Hexenverfolgung und damit die Hexenverbrennung beginnt im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation um das Jahr 1430 und erreicht ihren Höhepunkt im Dreißigjährigen Krieg. Mit der Hexenbulle vom 5. Dezember 1484, die Innozenz VIII. unterzeichnete, begann nicht nur offiziell die europäische Hexenverfolgung, sondern sie wurde auch von der Kirche systematisch angeordnet. Vor allem so genannte Hexenausschüsse in den vielen einzelnen Herrschaftsgebieten des Reiches veranlassten Prozesse gegen Hexen und ihre anschließende Verbrennung. Nicht immer, aber größtenteils wurden Frauen als Hexen verbrannt. Auch der Anlass dazu war nicht immer der Glaube an Geister und Teufel, sondern ebenso Kirchenaustritte oder Andersgläubigkeit der Betroffenen. Im damaligen Deutschland wurde die letzte "Hexe" erst Ende des 18. Jahrhunderts verbrannt.
Globale Hexenhatz
Schreckliche Wesen mit Zauberkräften, die den Menschen Böses wollen – dieser Glaube existiert seit uralten Menschheitszeiten in allen Kulturen. Bereits in der Antike glaubten in babylonischen oder ägyptischen Hochkulturen die Menschen an zaubernde Dämonen. Und sie wurden bereits seinerzeit verfolgt, verurteilt und getötet. Auch die Römer kannten solche Unheilbringer, die auch in der frühen christlichen Zeit ihre Macht in den Köpfen der Menschen nicht verloren. Besonders die Christen entwickelten früh daraus den Teufelspakt: der Tausch der menschlichen Seele gegen Macht und Geld.
Geduldete Hexen
In der Zeit von 500 bis 1250 orientierte sich die Kirche nach der Lehre des berühmten Kirchengelehrten Augustinus (354-430), wenn es darum ging, wie man mit Zauberern und Hexen umzugehen hat. In dieser Zeit gab es keine massenweisen Hexenjagden und –verbrennungen. Im Gegenteil: Hetzen und Racheakte waren nicht erwünscht. Die Bevölkerung handelte diesbezüglich oft eigenmächtig. In der kirchenrechtlichen Vorschrift "Canon episcopi" aus dem Jahr 906 werden Frauen als Hexen erwähnt: Sie gehen auf ihren Nachtflügen Pakte mit dem Teufel ein. Doch erklärte die Kirche damals, dass dies Wahnvorstellung der betroffenen Frauen seien, die obendrein einen anderen Glauben haben. Der Umgang mit ihnen ist Buße oder allerhöchstens der Verlust der Gemeindemitgliedschaft, was eine sozialen Verdammung bedeutete.
Die Jagd beginnt!
Mit der Rezeption und Auslegung der Schriften einer der bedeutendsten Kirchentheoretiker, Thomas von Aquin (circa 1225-1274), wechselte die Haltung der Kirche gegenüber Hexen, auch wenn Thomas von Aquin keine Einzelschrift über Hexen verfasste. Er schrieb bereits früh vereinzelt über Divination (Wahrsagerei) und Zauberei, aber selten ausdrücklich über Hexerei (maleficium). Bereits im ersten Buch der Bibel, Genesis, im kapitel 6, Vers 1 – 6, wird von der Zeugung von Gottessöhnen mit menschlichen Frauen gehandelt. Diese Geschehnisse interpretiert Thomas von Aquin auf natürliche Weise, indem Sukkuben als Dämonen diese Zeugung ermöglichen. Diese Ansichten wurden für die Hexenverfolgung uminterpretiert oder verfälscht, so dass besonders von Aquins frühe Schriften zur Hexenverfolgung unabsichtlich beitrugen. Ebenso erging es mit seiner Auffassung von der fascinatio, dem bösen Blick, die der aristotelischen Vorstellung folgte, dass Geistiges den Körper beeinflussen kann.
In der Folge erschienen viele Schriften und Predigten von Kirchengelehrten zu Hexen, die sie als Unheilbringerinnen, als Paktiererinnen mit dem Teufel darstellten. Die Bevölkerung ließ sich davon nicht nur anstecken, sondern in ihr wurde auch die Angst vor dem Bösen in Gestalt der Hexen geschürt. Intensiviert wurde der Hexenglauben noch dadurch, dass es sich bei ihnen nicht nur um Einzelwesen, sondern um komplette Sekten handelten. Diese Auffassung machte sich zu Beginn des 15. Jahrhunderts vor allem in der Schweiz breit. In Luzern wurde in einem Prozess gegen Hexerei erstmals der Begriff „hexery“ verwendet. Hexen fanden vor allem als nackte rothaarige Frauen auf einem Besen ihren Niederschlag in der Malerei oder als Szenen von der Hexenverbrennung.
Anleitung zum Hexenprozess
Auf den zunehmenden Hexenglauben reagierte die katholische Kirche auf dem Konzil in Basel (1431-1449) mit dem Aufruf der gezielten Jagd durch Inquisitoren und durch die Bevölkerung. Darunter der berüchtigte Heinrich Kramer (etwa 1430 - 1505), der 1478 zum Inquisitor ernannt wurde. Er verfasste 1484 einen Text zur Hexenverfolgung, den er von Papst Innozenz VIII. (1432-1492) abzeichnen ließ – die so genannte Hexenbulle. Sie legalisierte kirchlich die Hatz auf Hexen. Doch 1485 konnte ein Innsbrucker Bischof die Verurteilung einer Hexe verhindern, zugleich ließ er Kramer aus Tirol ausweisen. Daraufhin verfasste Kramer seinen berühmten Titel "Hexenhammer", in dem er unter anderem Regeln für Hexenprozesse festlegte. Das Buch wurde europaweit ein Bestseller. Nach Schätzungen sollen in den ersten 30 Jahren nach Buchveröffentlichung mehrere Tausend Hexen auf dem Scheiterhaufen gelandet sein.
Den Hexen wurde die erbärmliche Situation der Bevölkerung durch Kriege, Krankheitsepedemien wie Pest, Missernten oder Unwetterkatastrophen zugeschrieben. In der Zeit der Reformation ließ die Hexenverfolgung etwas nach. Auch schlossen sich ihr nicht alle Landes- oder Kirchenfürsten wie zum Beispiel in reformierten Gebieten an, sondern stellten sie unter Strafe. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts forcierte sich die Hexenhatz erneut durch Naturkatastrophen, Hungersnöte und den 30-jährigen Krieg. Einen ihrer Höhepunkte in West- und Südeuropa hatte sie in der Zeit von 1570 bis 1590. Im zentraleuropäischen Raum verschaffte ihr der Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) einen neuen Aufschwung. Es wurden beispiellosen Hexenjagden veranstaltet, die in Schnellverfahren mit anschließender Hinrichtung oder Verbrennung endeten. Auf diese Weise kamen allein im Kurfürstentum Köln in der Zeit von 1626 bis 1635 über 2000 Menschen ums Leben. Darunter zählten aber auch viele, die diese Morde verhindern wollten.
Aufklärung bringt das Ende der Hexenjagd
Mit dem Eintritt ins Zeitalter der Aufklärung beruhigte sich der Hexenglauben und die damit verbundende Jagd. Hexenprozesse wurden zunehmend seltener. Gelehrte verfassten Schriften gegen den Hexenglauben und gewannen damit selbst bei konservativen Klerikern immer mehr Einfluss. Die weltliche Rechtssprechung, vielerorts ausgerichtet auf Hexenverfolgung, wurde reformiert. Im Jahr 1782 fand die letzte vermeintliche Hexe in der Schweiz ihren Tod. Um 1800 gab es weitestgehend keine Magiedelikte mehr in den Gesetzestexten. Laut Schätzungen sollen etwa 50.000 Menschen durch Hexenhinrichtung den Tod gefunden haben, darunter 80 Prozent Frauen.
Top 10 der Biografien
Häufig aufgerufene Biografien dieser Woche:
Listen bedeutender Menschen
Die Formel 1 Weltmeister

Die Geschichte der Formel 1 ist eine lange und kollektive Leistung herausragender Fahrer, die im Laufe der Jahrzehnte die Königsklasse des Motorsports geprägt haben. Seit der ersten offiziellen Form...
Die Präsidenten der Vereinigten Staaten
Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (The President of the United States of America) ist das zentrale Symbol für die Macht und die Prinzipien der amerikanischen Demokratie. Als Staatsob...
Der Deutsche Aktienindex DAX

Die 30 DAX-Unternehmen und ihre Vorstände und AufsichtsräteDer DAX, Deutschlands bekanntester Aktienindex, spiegelt die Wertentwicklung der 40 größten und liquidesten Unternehmen des Landes wider....
Erfinder, Entdecker, Erleuchtete

Am 21. Juli 1969 betrat ein Amerikaner als erster Mensch den Mond. So wie Neil Armstrong damals "einen großen Schritt für die Menschheit" vollzog, haben zahlreiche Persönlichkeiten vor und nach ihm...
Die beste Tagebuch App
Unsere App für alle Geschichten - Diary.ClubErinnern ist nicht mehr das, was es einmal war. Es ist schneller geworden, kürzer, flüchtiger. Das Gestern verschwindet zwischen zwei Swipes, das Morgen ...