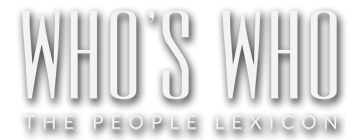Die Französische Revolution 1789 - 1799
Eines der folgenreichsten Ereignisse der neuzeitlichen europäischen Geschichte.
Am 14. Juli 1789 begann mit Unterstützung der Gardes Françaises, den Haustruppen des Königs, der Sturm des dritten Standes auf die Pariser Festung Bastille – ausgelöst durch hohen Abgabedruck und soziale Ungerechtigkeiten. Damit wurde das Fanal zur Französische Revolution gesetzt, obgleich der Generalstand des dritten Standes sich zuvor auf der Versammlung der Generalstände in Versaille zur Nationalversammlung erklärt und Beratungen zur Neuordnung der absolutistischen Ständegesellschaft begonnen hatte. Die Französische Revolution von 1789 gilt als eines der wichtigsten Ereignisse in der europäischen Geschichte der sozialen und gesellschaftlichen Entwicklung. Mit ihr wurden absolutistische Herrschaftsformen und klerikale und adelige Vorrechte als Kennzeichen des Ancien régime aufgehoben. Das zentrale Motto der Französischen Revolution hieß liberté, egalité, fraternité (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit). Die Umwälzung vollzog sich in ihrer Folge in drei Phasen.
Vorgeschichte
Im Ancien régime zahlte nur der dritte Stand, bestehend aus Bürgern, Bauern, Geschäftsleuten, Intelektuellen und Tagelöhnern, Abgaben. Er trug den Staatshaushalt und finanzierte das Leben des Klerus (1. Stand) und des Adels (2.Stand). Die Staatschulden und zugleich die Unzufriedenheit des 3. Standes mit der absolutistischen Ständegesellschaft wurden immer größer. In der Krise berief König Ludwig XVI. am 5. Mai 1789 die Versammlung der Generalstände, bestehend aus Mitgliedern aller drei Stände, in Versaille ein. Im Vorfeld wurden Forderungen zur Abschaffung der absolutistischen Ständegesellschaft und zu anderen Reformen immer lauter. Auf der Versammlung wurde der dritte Stand enttäuscht, der König zeigte sich nicht interessiert an Reformen, sondern lediglich an der Sanierung des Staatshaushaltes. Der bürgerliche Stand, darunter die beiden prominenten Wortführer Abbé Sieyès und Graf Mirabeau, ergriff die Initiative und rief sich am 17. Juni 1789 zur Nationalversammlung aus.
Anerkennung der Nationalversammlung
Die beiden anderen Stände schlugen mehrheitlich die Einladung zur Mitarbeit aus, nur ein Teil aus niederem Klerus und liberalem Adel schloss sich an. Die Nationalversammlung wurde von der Versammlung der Generalstände ausgeschlossen. Sie leistete im Ballhaus den Schwur, sich erst nach Zustandekommen einer neuen Verfassung zu trennen. Der Druck der revolutionsbereiten Öffentlichkeit ließ Ludwig XVI. die Nationalversammlung anerkennen, nachdem sich ihr auf sein Geheiß hin die beiden anderen Stände angeschlossen hatten. Am 9. Juli 1789 fand sie sich zur verfassunggebenden Nationalversammlung (Asemblée nationale constituante) zusammen. Doch zugleich zog Ludwig XVI. seine Truppen in Paris zusammen. Mit Empörung nahm die Bevölkerung die Entlassung des Finanziministers Jacques Necker (1732 – 1804) wahr, der unter anderem die Verdoppelung der Stimmenanzahl des dritten Standes in der Generalständeversammlung empfohlen hatte. Dieser Vorgang und die Militärpräsenz führte am 14. Juli 1789 zur Erstürmung der Bastille als Symbol der absolutistischen Macht, in dem auch das Staatsgefängnis untergebracht war.
Reformen und Absetzung des Königs
In den Revolutionsunruhen bildeten sich eine provisorische Regierung und eine Nationalgarde als Bürgermiliz. Ludwig XVI. berief Necker erneut als Minister. Die Nationalversammlung beschloss zahlreiche Reformen: unter anderem am 4. und 5. August im Revolutionsjahr die Beseitigung der feudalen Standesrechte und anderer Privilegien sowie die Aufhebung des geistlichen Zehnts, am 26. August verkündete sie die Menschen- und Bürgerrechte, am 2. November beschloss sie die Säkularisierung der Kirchengüter, im Januar 1790 die Verwaltungsreform und Unterteilung des Landes in 83 Departements, am 19. Juni 1790 die Abschaffung des Erbadels und am 12. Juli 1790 die Zivilverfassung für den Klerus. Im Juni 1792 missglückte die Flucht Ludwigs XVI. nach Metz. Am 3. September 1790 verkündete die Nationalversammlung die neue Verfassung, in der noch eine konstitutionelle Monarchie geplant war. Doch der Fluchtversuch des Königs und das Massaker auf dem Marsfeld, angezettelt durch die Nationalgarde zur Niederschlagung einer Demonstration republikanischer Mitglieder der Nationalversammlung, ebneten den Weg zur Republik Frankreich. Dieser wurde von den Girondisten gefordert.
Manifest vom 25. Juli 1792
Im Ausland drängte Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel, Herzog von Braunschweig und Oberbefehlshaber der österreichisch-preußischen Truppen, in einem Manifest vom 25. Juli 1792 auf die Restauration der französischen Monarchie als Ziel des ersten Koalitionskrieges (1792 – 1797). Daraufhin setzten die Girondisten am 20. April 1792 in der Nationalversammlung die Kriegserklärung an Österreich und Preußen durch. Die Bevölkerung in Paris lehnte die Monarchie gleichfalls ab und erstürmte am 10. August 1792 die Tuilerien, die Residenz des Königs. Ludwig XVI. wurde abgesetzt und samt seiner Familie verhaftet. Damit verschärfte sich der Revolutionskonflikt zwischen Republikanern und Gegenrevolutionären deutlich. Es wurde die Wahl eines Nationalkonvents (Convention nationale) als erste französische Versammlung, deren Mitglieder durch allgemeines Wahlrecht ohne Klassenunterschiede gewählt wurde, beschlossen.
Schreckensherrschaft
In den Septembermorden 1792 fanden viele politische Gefangene, Geistliche und Royalisten den Tod. Nach einer Verhandlung wurde am 21. Januar 1793 der Bürger Capet, Ludwig XVI., hingerichtet. Die Bergpartei, eine Gruppe der Jakobiner, eroberte sich im Nationalkonvent die Mehrheit und ließ einige führende Girondisten verhaften. Ab Juni 1793 begann die so genannte Jakobinerherrschaft mit Robbespierre und dem Wohlfahrtsausschuss als Exekutive. In diese Zeit fiel auch die Schreckensherrschaft (La Grande Terreur), in der Robbespierre mit radikalen Maßnahmen jegliche Versuche einer Gegenrevolution unterdrückte. Ihr fielen rund 40.000 Menschen zum Opfer, darunter führende Köpfe des Clubs des Cordeliers wie Danton oder Hébert. Am 27. Juli 1794 kam es zum Sturz von Robbespierre, der kurz darauf mit anderen Gefolgsleuten hingerichtet wurde. Bis Ende 1794 führten gemäßigte Republikaner den Nationalkonvent.
Napoleons Machtübernahme
Am 31. Oktober 1795 wurde das Direktorium oberstes Regierungsorgan, nachdem sich Nationalkonvent und Wohlfahrtsausschuss aufgelöst hatten. Ihm gehörten unter anderem politische Persönlichkeiten wie Charles Maurice de Talleyrand-Périgord und Joseph Fouché an. Doch auch sie konnten den Staatsbankrott vom 30. September 1797 nicht abwehren. Im zweiten Koalitionskrieg übernahm am 09. November 1799 (dem 18. Brumaire VIII) der Artilleriegeneral Napoléon Bonaparte in einem Staatsstreich die Macht und ließ sich auf militärischem Druck zum Ersten Konsul einsetzen. Er übte faktisch die Alleinherrschaft aus. Am 02. Dezember 1804 krönte er sich in der Kathedrale Notre Dame de Paris selbst zum Kaiser.
Top 10 der Biografien
Häufig aufgerufene Biografien dieser Woche:
Listen bedeutender Menschen
Die Formel 1 Weltmeister

Die Geschichte der Formel 1 ist eine lange und kollektive Leistung herausragender Fahrer, die im Laufe der Jahrzehnte die Königsklasse des Motorsports geprägt haben. Seit der ersten offiziellen Form...
Die Präsidenten der Vereinigten Staaten
Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (The President of the United States of America) ist das zentrale Symbol für die Macht und die Prinzipien der amerikanischen Demokratie. Als Staatsob...
Der Deutsche Aktienindex DAX

Die 30 DAX-Unternehmen und ihre Vorstände und AufsichtsräteDer DAX, Deutschlands bekanntester Aktienindex, spiegelt die Wertentwicklung der 40 größten und liquidesten Unternehmen des Landes wider....
Erfinder, Entdecker, Erleuchtete

Am 21. Juli 1969 betrat ein Amerikaner als erster Mensch den Mond. So wie Neil Armstrong damals "einen großen Schritt für die Menschheit" vollzog, haben zahlreiche Persönlichkeiten vor und nach ihm...
Die beste Tagebuch App
Unsere App für alle Geschichten - Diary.ClubErinnern ist nicht mehr das, was es einmal war. Es ist schneller geworden, kürzer, flüchtiger. Das Gestern verschwindet zwischen zwei Swipes, das Morgen ...